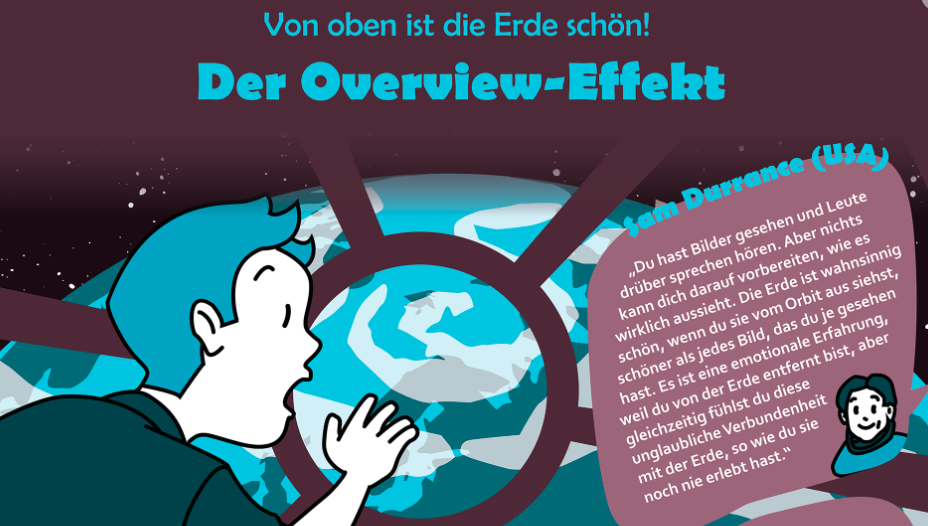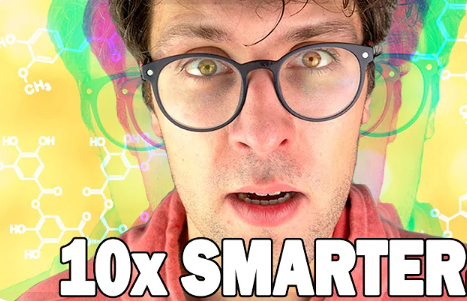Seit 2013 kürt Fast Forward Science jährlich den besten Science Content auf Social Media – zehn Jahre voller Begeisterung für die Wissenschaft, aber auch voller Veränderung. 🏆🔬 2013 gab es noch kein TikTok, Instagram zählte 100 Millionen Nutzer*innen – heute sind es über 2 Milliarden 😲📱 –, und Wissenschaft auf YouTube war noch eine Nische. Dann hat sich fast forward nicht nur Social Media geändert – durch neue Plattformen, neue Formate und exponentiell wachsende Nutzer*innenzahlen –, sondern mit und durch Social Media auch die Wissenschaftskommunikation. 👥🌐📢 Science Content ist aus YouTube nicht mehr wegzudenken und auch auf Instagram und TikTok mischt Wissenschaft mit neuen Perspektiven und spannenden Forschungsergebnissen die Feeds auf. 🔍💡 Wie wohl Wissenschaft auf Social Media in zehn Jahren kommuniziert wird? 🤔📲
Anlässlich unseres zehnjährigen Jubiläums haben wir in den letzten Wochen auf unseren Social Media-Kanälen zurückgeschaut: Wir haben Gewinner*innen-Beiträge in Erinnerung gerufen und Revivals von Social Media Trends und Challenges von 2013 bis heute gepostet – wer fühlt sich noch alt? 🎉🎂📅
Und weil’s so schön war, nehmen wir euch hier noch einmal mit auf unsere Zeitreise durch Wissenschaft und Social Media. 🚀🔍
Beginnen wir 2013: Es wurde gerappt und erklärt. Es ging um die Mitternachtsformel, Attosekunden, um Farben und Fracking. Vier Beiträge wurden damals ausgezeichnet in den Kategorien PRO, NEXT, KOMMUNIKATION. Zusätzlich wurde der Spezialpreis der Jury vergeben.🏆 Und was ging sonst noch so im Internet? Erinnert ihr euch noch an die Harlem Shake Challenge? Über 40.000 Nachahmer*innen verbreiteten Videos, in denen sie flashmobartig den Tanz nachstellten. 💃🕺
Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an
Im Jahr 2014 wurden bei Fast Forward Science in den Kategorien SUBSTANZ für Beiträge mit besonderer wissenschaftlicher Tiefe, und SCITAINMENT, in denen Wissenschaft unterhaltsam vermittelt wird, jeweils drei Beiträge ausgezeichnet, in der Kategorie SUPER FAST zwei. 🏆🎉 Die Kategorie SUPER FAST war damals an eine Challenge gebunden: Ein bestimmtes Thema wurde bekannt gegeben und innerhalb von 48 Stunden sollten Beiträge produziert werden. Auch in diesem Jahr waren die Themen der Beiträge wieder so vielfältig wie Wissenschaft sein kann: Es ging um Gletscher, um Muskeln und um die kleinsten physikalischen Teilchen. ❄️💪🔬 Social Media war vor allem von einer Challenge wortwörtlich geflutet: der Ice-Bucket-Challenge! Die Challenge sollte auf die Krankheit Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) aufmerksam machen und bis Ende 2014 wurden unglaubliche 200 Millionen US-Dollar für die ALS-Forschung gesammelt. Bis heute wirkt die Challenge nach und hat einen Impact auf die Sichtbarkeit der Krankheit in Forschung und Gesellschaft. Das zeigt: Wissenschaft beeinflusst nicht nur die Inhalte auf Social Media – sondern Social Media kann auch einen Impact auf Wissenschaft haben! 🤝🌐🚀
Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an
Während 2014 noch acht Beiträge ausgezeichnet wurden, waren es 2015 schon zwölf!🎉 Mit dabei auch der YouTube-Kanal SimpleClub, der bei der einen oder anderen Person in der Zeit vielleicht schon die Schulzeit begleitet hat! 🎥🎓 Außerdem wurden Videos über Medienkonvergenz, Magma und Teilchenbeschleuniger ausgezeichnet. 📽️🌋🚀 Auf Platz 1 der Kategorie SUBSTANZ landete das Video Constraints on the Universe as a Numerical Simulation, in dem es um die Frage geht, ob vielleicht alles um uns herum eine Simulation ist. Realität – was ist das schon? 🌌💻 Auch #TheDress ließ 2015 viele an der Realität oder zumindest unserer Wahrnehmung der Realität (ver)zweifeln. Ist dieses Kleid jetzt schwarz-blau oder weiß-gold? 👗🤔 Sogar bei einem Hashtag kann Wissenschaft Abhilfe schaffen: Farbpsychologisch können die unterschiedlichen Wahrnehmungen der Farben damit erklärt werden, dass Personen die farbliche Umgebung des Kleides unterschiedlich hell sehen. Sprich: Wer die Umgebung als hell wahrnimmt, sieht das Kleid eher schwarz-blau, wer das Kleid in einem dunklen Raum sieht, erkennt weiß-gold. 🌈💡
Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an
Im Jahr 2016 stand die Welt still. Zumindest die Personen in der Mannequin-Challenge, die damals das Internet mit Stillstand fluteten. Fun Fact: Die Videos der Challenge wurden später dafür verwendet, Künstliche Intelligenzen zu trainieren. Da KIs mit der Erkennung von sich bewegenden Personen noch überfordert wären, nutzten die Forscher*innen die Mannequin-Challenge, damit die Systeme zunächst mit stillstehenden Personen üben konnten – wer kann hier noch sagen, dass Internetphänomene keinen Nutzen haben? Ein Internetphänomen, das ein ziemlicher Booster für die Wissenschaftskommunikation auf YouTube war, ist der Kanal maiLab von der Chemikerin Mai Thi Ngyuen-Kim, die heute mit ihrer Fernsehshow MaiThink X Menschen für Wissenschaft begeistert! 🧪🔬🎥 2016 gewann sie mit einem Video auf ihrem damaligen YouTube-Kanal The Secret Life of Scientists und in den letzten sieben Jahren ist sie zu einer der wichtigsten Wissenschaftskommunikator*innen Deutschlands geworden und aus der Social Media-Welt nicht mehr wegzudenken. 🏆💻
Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an
Das Distracted Boyfriend-Meme ist wohl aus der Meme-Landschaft nicht mehr wegzudenken. Seit 2017 bereichert es die Kommunikation und sagt dabei oft mehr als 1000 Worte. 🗣️💬 Bei Fast Forward Science wurden im gleichen Jahr 13 Beiträge ausgezeichnet. it dabei ein mittlerweile bekanntes Gesicht bei FFSci: Doktor Whatson begeistert mit seinen Videos nicht nur bis heute regelmäßig auf YouTube, sondern wurde in den letzten Jahren auch immer wieder für preiswürdigen Content ausgezeichnet. 🏆🧪 Im Jahr 2017 gewann er in der Kategorie … mit seinem Video Können wir unsere Gehirne hacken.🧠💻
Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an
Auch im Jahr 2018 wurden vielfältige Beiträge prämiert und immer wieder verarbeiteten Preisträger*innen Themen, die heute weiterhin aktuell oder sogar aktueller denn je sind: So zum Beispiel Julian Witusch auf seinem YouTube-Kanal JWreloaded, der auf dem 1. Platz in der Kategorie VISION für sein Video Was ist künstliche Intelligenz? ausgezeichnet wurde. 🏆🤖📹 Ein Grund mehr, sich mal durch den Content der Preisträger*innen der letzten Jahre zu klicken, um zu sehen, was 2018 schon und 2023 noch aktuell ist. 👨🔬🔍 Ebenfalls (nach wie vor) hoch aktuell ist der in der Kategorie WEBVIDEO EXCELLENCE ausgezeichnete Beitrag: Sektorenkopplung: Wie die Energiewende in Level 2 weitergeht? Content aus der Wissenschaft kann oft beides: Hochaktuelle Forschung vermitteln und gleichzeitig darüber hinaus relevant bleiben.🌐🔬
Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an
Auch relevant: 2029 geht die Welt unter. Also vielleicht. Wahrscheinlich. Also nicht sehr wahrscheinlich. Wie wahrscheinlich genau erfahrt ihr im Video von MariusAngeschrien, der mit Wie wahrscheinlich ist der Weltuntergang? 2019 auf Platz 1 in der Kategorie SCITAINMENT ausgezeichnet wurde. 🌍🤔📹 Damals noch zehn Jahre hin, ist der Weltuntergang durch einen Asteroiden inzwischen schon in sechs Jahren – zum Glück ist das wissenschaftlich sehr, sehr unwahrscheinlich. ☄️🙅♂️ Nicht nur wahrscheinlich, sondern bereits eingetreten ist wiederum ein anderes Szenario, das Marius als mögliches Weltuntergangsszenario erwähnte: eine Pandemie.😷 Aber, auch hier wissen wir: Trotz harter Jahre und viel Dramatik,untergegangen ist die Welt nicht. 🌟🌏
Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an
Für die Wissenschaftskommunikation waren die Jahre der Corona-Pandemie eine Herausforderung, aber auch ein Booster. Mit viel Engagement und Power produzierten Content Creator*innen Beiträge, in denen sie über Corona aufklärten und so gegen Falschinformationen vorgingen. 📢💪 Das zeigte sich auch bei Fast Forward Science: Auf Platz 1 der Kategorie SCITAINMENT wurde Marlene Heckl alias Doktor Wissen für ihr Video Bester Corona-Schutz: Seife oder Desinfektion? ausgezeichnet. Auch in Erinnerung aus diesem Jahr wird das YouTube-Video Corona geht gerade erst los von maiLab bleiben. Der meistgesehene YouTube-Beitrag 2020 in Deutschland zeigt den Stellenwert, den Wissenschaft mittlerweile in der YouTube-Welt hat. 📈🌍
Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an
2021/22 erstrahlte Fast Forward Science in neuem Glanz: Mit dem YOUNG SCIENTIST AWARD, SCIENTIST & RESEARCH INSTITUTION AWARD und TANDEM AWARD sowie den Spezialpreisen AUDIO und OPEN BOX wurden die Kategorien umgekrämpelt. 🌟🏆🎉 Nicht nur die Kategorien änderten sich, sondern es wurde erstmals auch TikTok-Content ausgezeichnet: Amelie Reigl alias @dieWissenschaftlerin begeisterte als Young Scientist mit ihrem TikTok über ein Experiment, bei dem Wissenschaftler*innen einem Frosch ein Bein nachwachsen lassen konnten. 🐸🧪💡
Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an
Nach 2021/22 kommt …? Richtig: 2022/23 und damit die aktuelle und 10. Wettbewerbsrunde, die mit der Preisverleihung am 17. Juni in Hamburg ihr feierliches Ende fand. Es wurden wieder Beiträge ausgezeichnet, die uns vielfältige, spannende und faszinierende Einblicke in die Wissenschaft geben. 👩🔬🌌🔬Ob über Neuroplastizität, die 4-Tage-Woche oder den Overview-Effekt – die Preisträger*innen zeigten auch in diesem Jahr ihre Begeisterung für die unterschiedlichsten Themen. 🧠💼🚀 Wer noch einmal den ausgezeichneten Content von dieser und allen anderen Runden bingen will, kann das wie gewohnt auf unserer Website tun. 🖥️🎥
Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an
10 Jahre Fast Forward Science – auf Social Media hat sich viel verändert. Einige Veränderungen sind auch in den Einreichungen über die Jahre des Wettbewerbs hinweg sichtbar. Was wohl die nächsten Jahre im (Science) Content der Social Media-Welt auf uns zukommt? Wir sind auf jeden Fall gespannt! 🌐🤔
Danke an alle, die Fast Forward Science in den vergangenen Jahren unterstützt haben und vor allem danke an alle Content Creator*innen, die ihre Begeisterung für Wissenschaft teilen und damit anderen Menschen auf Social Media Zugang zu der faszinierenden Welt der Wissenschaft ermöglichen! 🙏👏🌟